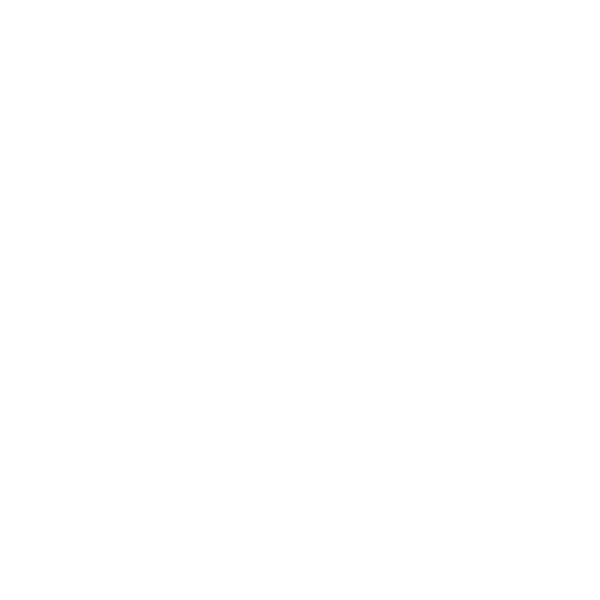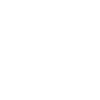Was war passiert?
Der Entscheidung liegt der Abschluss eines Pachtvertrages über Verkaufsflächen in einem Einkaufszentrum im Jahr 2018 zugrunde. Bevor im Frühjahr 2019 der Betrieb der neuen Filiale aufgenommen wurde, wurde das Einkaufszentrum vom neuen Eigentümer für 11 Monate geschlossen und saniert. Das Vorhaben wurde nicht bei der Bundeswettbewerbsbehörde (“BWB“) angemeldet.
Die BWB brachte im Oktober 2021 einen Abstellungsantrag und einen Antrag auf Verhängung einer angemessenen Geldbuße wegen Verstoß gegen das Durchführungsverbot beim Kartellgericht (“KG“) ein. Mit Beschluss vom 15.05.2023 bestätigte das KG das Vorliegen eines anmeldebedürftigen Zusammenschlusses, verhängte jedoch keine Geldbuße aufgrund mangelnder Strafwürdigkeit. Die BWB und der Bundeskartellanwalt erhoben jeweils Rekurs beim Kartellobergericht (“KOG“) gegen diese Entscheidung.
Ende 2023 bestätigte das KOG das Vorliegen eines anmeldepflichtigen Zusammenschlusses und trug dem KG die Festsetzung einer Geldbuße in “spürbarer” Höhe auf. Die im Verfahren geltend gemachten Argumente (ua), dass aufgrund der 11-monatigen Schließung des Einkaufszentrums kein “Kundenstamm” übernommen wurde, vermochte das KOG nicht zu überzeugen. Das KOG hielt fest, dass der Erwerb eines bloßen Bestandrechts nicht der Erfüllung des Zusammenschlusstatbestands des § 7 Abs 1 Z 1 KartG entgegensteht. In der Übernahme eines in mehrfacher Hinsicht bekannten Standorts sei der Erwerb eines die Dauer der Schließung überdauernden Aktivvermögens zu sehen, der den Eintritt in die Marktposition des zuvor betriebenen Lebensmitteleinzelhandels ermöglichte (OGH, 30.11.2023, 16Ok4/23h).
Im zweiten Rechtsgang verhängte das KG im Frühjahr 2024 eine Geldbuße von EUR 1,5 Mio. Dagegen erhoben die BWB und der Bundeskartellanwalt neuerlich Rekurs.
Zur Entscheidung
Mit der Entscheidung verhängte das KOG infolge der Rekurse der BWB und des Bundekartellanwalts eine Geldbuße iHv EUR 70 Mio.
Das KOG verweist bei seiner Geldbußenbemessung darauf, dass Geldbußen nach dem KartG präventive und repressive Zwecke verfolgen, was eine angemessene Höhe erfordere, weil sonst keine abschreckende Wirkung erzielt werden würde.
Bei der Bemessung der Geldbuße berücksichtigte das KOG vor allem erschwerend (i) die Dauer der Zuwiderhandlung, (ii) die hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin, (iii) die hohen Marktanteile der beteiligten Unternehmen und mildernd (i) das Nichtvorliegen einer Bereicherung, (ii) den geringen Umfang des räumlich betroffenen Marktes, (iii) den (bloßen) Verstoß gegen das Durchführungsverbot ohne Erfüllung eines Untersagungstatbestands und (iv) den Beitrag der Antragsgegnerin zur Aufklärung des Sachverhalts.