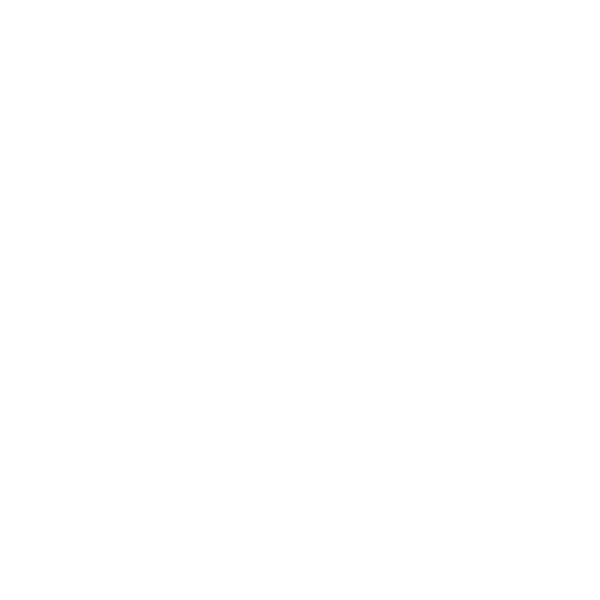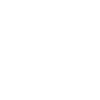Vor dem Hintergrund des europäischen Grünen Deals ist in der EU das Thema, ob Nachhaltigkeitsaspekte im Kartellrecht eine Rolle spielen können, in den Fokus gerückt. Zentrale Fragen waren insb, ob Umwelt- und Klimainitiativen zwischen Wettbewerbern (sog “Nachhaltigkeitsvereinbarungen” oder “-kooperationen“) vom Kartellverbot ausgenommen werden können und unter welchen Voraussetzungen.
Während sich die Europäische Kommission in ihren überarbeiteten Leitlinien zur Anwendbarkeit des Art 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit dieses Themas annahm, ging der österreichische Gesetzgeber sogar einen Schritt weiter und schuf im Zuge des Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2021 eine in der EU bislang einzigartige Nachhaltigkeitsausnahme in § 2 Abs 1 KartG. Dazu wurde der Satz “Die Verbraucher sind auch dann angemessen beteiligt, wenn der Gewinn, der aus der Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder der Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts entsteht, zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft wesentlich beiträgt” neu aufgenommen. Mit den Leitlinien zur Anwendung von § 2 Abs 1 KartG auf Nachhaltigkeitskooperationen (“Nachhaltigkeits-LL“)[1] bietet die Bundeswettbewerbsbehörde (“BWB“) den Rechtsanwender:innen bei deren kartellrechtlichen Beurteilung von geplanten Nachhaltigkeitskooperationen eine ausführliche Hilfestellung.
Dass Nachhaltigkeitskooperationen erfolgreich im Einklang mit dem Kartellrecht umgesetzt werden können, zeigen aktuelle Entscheidungen von Wettbewerbsbehörden: So äußerte die niederländische Wettbewerbsbehörde in 2024 keine Wettbewerbsbedenken gegen die Einführung eines branchenweiten Nachhaltigkeitsstandards des Handelsverbandes für den E-Commerce-Sektor für Online-Shops. Auch das deutsche Bundeskartellamt hat 2024 keine Bedenken bezüglich eines Nachhaltigkeitsstandards für Mehrwegsysteme für den B2B-Transport von Topfpflanzen statt Einwegträgern (sog “Trays”) geäußert. Ebenso genehmigte die japanische Wettbewerbsbehörde letztes Jahr eine Nachhaltigkeitskooperation zur Kohlenstoffneutralität zwischen fünf Petrochemie-Unternehmen, die im selben Businesspark angesiedelt waren.
Die österreichische Nachhaltigkeitsausnahme
Nach der Nachhaltigkeitsausnahme gemäß § 2 Abs 1 KartG kann eine wettbewerbsbeschränkende Nachhaltigkeitskooperation unter den Voraussetzungen, dass (i) die Kooperation über die Effizienzgewinne zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft beiträgt (dh rein wirtschaftliche, soziale oder Tierwohlaspekte sind davon nicht erfasst) und (ii) das EU-Wettbewerbsrecht mangels Erfüllung des Zwischenstaatlichkeitskriterium nicht zur Anwendung kommt, vom Kartellverbot ausgenommen sein.
Für die Nachhaltigkeitsausnahme müssen folgende fünf Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden:
- Die Kooperation führt zu Effizienzgewinnen;
- Die Effizienzgewinne leisten einen Beitrag zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft;
- Dieser Beitrag zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft ist wesentlich;
- Die durch die Kooperation auferlegten Beschränkungen sind unerlässlich für die Verwirklichung der Effizienzgewinne, die wesentlich zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft beitragen; und
- Durch die Kooperation wird nicht die Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren oder Dienstleistungen den Wettbewerb auszuschalten.
Die Nachhaltigkeits-LL der BWB
Zwar sind – soweit ersichtlich – noch keine Entscheidungen der BWB betreffend Nachhaltigkeitsvereinbarungen veröffentlicht worden, jedoch hat die BWB in ihren Nachhaltigkeits-LL dargelegt, wie sie die Nachhaltigkeitsausnahme in der Praxis konkret anwenden wird. Hinsichtlich der oa fünf Voraussetzungen hält die BWB fest, dass
- die Effizienzgewinne die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt erhöhen müssen und dass auch solche für spätere Generationen miteinbezogen werden können (bspw bei drohenden irreversiblen Umweltschäden);
- beim Kriterium der Unerlässlichkeit
- sog Mitnahmeeffekte nicht relevant sind (dh es sind nur Effizienzgewinne zu berücksichtigen, die sich nicht ohnehin im Wettbewerb einstellen würden),
- die angemessene Dauer (die Kooperation darf nur solange bestehen, wie dies objektiv notwendig ist) und
- der angemessene Umfang (die Kooperation darf keine Nebenabreden enthalten, die für das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels nicht unerlässlich sind) zu prüfen sind;
- bei den ökologischen Vorteilen ua darzulegen ist, welche Vorteile in welchem Zeitraum erzielt werden und wie die Kooperation dazu beiträgt sowie, dass durch die Kooperation kein zusätzlicher Schaden entsteht; und
- die Prüfung der Wesentlichkeit erfordert, dass die negativen Wettbewerbsauswirkungen am betroffenen Markt zumindest ausgeglichen werden, wobei die Abwägung der positiven und negativen Effekte quantitativ oder qualitativ erfolgen kann.
Was ist nun zu tun?
Unternehmen sollten von den neuen Möglichkeiten, die die österreichische Nachhaltigkeitsausnahme mit sich bringt, Gebrauch machen, um Synergien im Rahmen von Nachhaltigkeitskooperationen mit Wettbewerbern zu heben. Die einleitend angeführte Entscheidungspraxis anderer Wettbewerbsbehörden zeigt, dass Nachhaltigkeitskooperationen kartellrechtskonform zum Vorteil der beteiligten Unternehmen umgesetzt werden können.